Psychologie und die sozialen Medien
November 6, 2019
Die Psychologie der sozialen Medien ist komplex. Im Vortrag von Sarah Genner wurden zahlreiche Aspekte gestreift und an einigen Stellen vertieft.
Die Wirkung der neuen Medien wird kontroves diskutiert. Problematisch an extrem pessimistischen Positionen ist oftmals, dass ihre Vertreter kausale Zusammenhänge herstellen, wo tatsächlich nur Korrelationen vorliegen. Beispiel: Schlechte Schulleistungen allein auf einen hohen Medienkonsum zurückzuführen ist insofern wissenschaftlich problematisch, weil dabei andere Faktoren ausgeblendet werden, die ebenfalls eine Rolle spielen können: Wenn die Eltern sich nicht dafür interessieren, ob ihr Sprössling seine Hausaufgaben macht, kann dies eine wichtigere Rolle für den Schulerfolg spielen als der Medienkonsum. Angebracht ist daher eher ein kritischer Optimismus. Ein solcher verkennt aber beispielsweise nicht, dass die neuen Medien tatsächlich ein Suchtpotenzial bergen. Soziale Netwerke funktionieren so, dass das Belohnungszentrum im Gehirn fortwährend stimuliert wird. Dieses sorgt für ein anhaltend hohes Level des Wohlfühlhormons Dopamin im Blut: Offline fällt schwer.

Wirklichkeit ist ein Konstrukt, an dessen Herstellung die (sozialen) Medien stark beteiligt sind. Techniken wie «framing» werden verwendet, um die Meinungsbildung in eine bestimmte Richtung zu lenken bzw. zu manipulieren. Durch die gezielte Verwendung bestimmter Begriffe legt beispielsweise ein Artikel nahe, wie ein Ereignis zu interpretieren ist. Die Verwendung eines anderen Deutungsrahmens durch den Gebrauch anderer Begriffe kann die Interpretation desselben Ereignisses in eine ganz andere Richtung lenken.

Die Wirkung von sozialen Medien kann sich in überraschenden sozialpsychologischen Effekten äussern, etwa in sogenannten «Schweigespiralen»: Personen, die ihre Meinung nicht dominant in den Massenmedien repräsentiert sehen, neigen dazu, diese für sich zu behalten. Dass es sich dabei tatsächlich um eine «schweigende Mehrheit» handeln kann, hat der Sieg Donald Trumps über Hillary Clinton im letzten US-Wahlkampf gezeigt. Ausser Michael Moore haben diesen Sieg wohl nur wenige vorausgesagt.
Der Begriff Digital Natives definiert die Kohorte der ab 1980 Geborenen. Deren Sozialisierung wurde von Kindheit an von den sozialen Medien mitgeprägt. Diese Gruppe ist allerdings keineswegs homogen. Die Haltung der Mitglieder dieser Gruppe gegenüber dem Internet korreliert stark mit ihrer sozialen Lage. Personen mit niedrigem sozialen Status fühlen sich tendenziell vom Internet überfordert. Am anderen Ende des sozialen Spektrums steht die Gruppe derer, die das Internet souverän nutzen und sich in einem hohen Mass damit identifizieren. Und: Wer über wenig öknomisches und kulturelles Kapital verfügt, ist eher anfällig für «Fake News».
Unsere Einstellung zu den sozialen Medien und unser Nutzerverhalten hängen von unserer Persönlichkeit ab. Eher extrovertierte Personen nutzen die sozialen Medien häufiger als introvertierte Personen. Letztere hingegen geben online mehr von sich preis als sie das face-to-face tun würden. Und wer prinzipiell aufgeschlossen ist für neue Erfahrungen, zeigt diese Offenheit auch im Umgang mit den sozialen Medien. Aus dem Verhalten auf Facebook jedoch zurückschliessen zu können auf die Persönlichkeit eines Nutzers, um diesen dann durch entsprechende Botschaften gezielt zu manipulieren, ist eine umstrittene These: Donald Trump hat seinen Wahlsieg wohl eher nicht (nur) Cambridge Analytica zu verdanken. Um bei Trump zu bleiben: Das Internet macht Menschen nicht zu Narzissten. Wohl aber finden Narzissten in den sozialen Medien eine hervorragende Plattform, um ihren Geltungsdrang auszuleben.
Im Schutz der Anonymität des Internets lässt es sich leider wunderbar trollen. Solche Individuen lassen häufig alle Hemmungen fallen, weil sie wissen, dass sie nur schwer sanktioniert werden können.
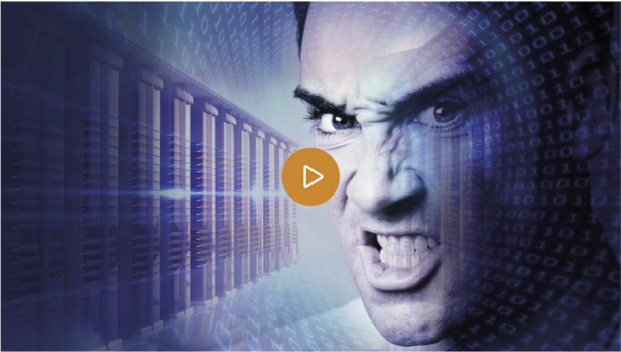
Empathie kann sich gar nicht erst regen, weil die emotionale Reaktion des Gegenübers anders als in einer face-to-face Situation online nicht wahrgenommen werden kann. Emoticons sind nur der Versuch, emotionale Regungen symbolisch zu ersetzen. Klare Verhaltensregeln bzw. Netiquette können bei der Betreuung von sozialen Netzwerken zumindest helfen, einen gewissen Mindeststandard von Anstand und Respekt in der Online-Kommunikation durchzusetzen.
Vom Suchtpotenzial der sozialen Medien war bereits die Rede. Es gibt gute Gründe, warum sich eine gewisse persönliche Hygiene im Umgang mit den sozialen Medien empfiehlt. Die Symptome von «always on» können erwiesenermassen von Schlafstörungen über Augenschäden bis zum Burnout reichen. Dem lässt sich entgegenwirken, indem man Zeiten (mit sich selbst) vereinbart, in denen das Handy aus bleibt. Einfache Hilfsmittel wie Uhr und Wecker können helfen, dem Griff zum Handy zu widestehen. Und wer diese Selbstdisziplin nicht aufbringt, kann sich durch technische Blockaden freiwillig Zeiten auferlegen, in denen das Smartphone offline bleibt. In diesem Sinne: Prioritäten setzen, ein gesundes Verhältnis zu den Sozialen Medien entwickeln – und das «echte» Leben nicht verpassen!

Unser Newsletter liefert dir brandaktuelle News, Insights aus unseren Studiengängen, inspirierende Tech- & Business-Events und spannende Job- und Projektausschreibungen, die die digitale Welt bewegen.